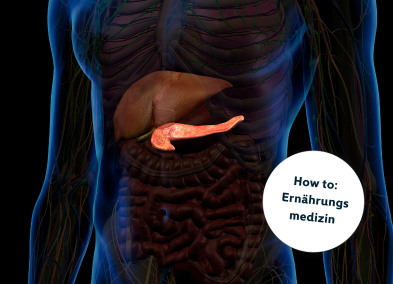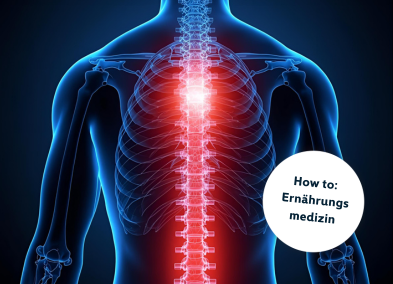Der besondere Fall – Superfood
Patientendaten und Anamnese:
Ein 35-jähriger Mann ohne bekannte Vorerkrankung stellte sich zur Abklärung der bei einem hausärztlichen Check-up gefundenen, erhöhten Leberwerte vor:
ASAT 88 IU/l (Normwert <50 U/l), ALAT 92/l (Normwert <50 U/l), ɣ-GT 121 IU/l (Normwert <60 U/l.
-
- übrige Laborwerte (rotes und weißes Blutbild, Entzündungsparameter, Nierenwerte, Blutzucker, Lipidstatus, TSH, Parameter des Eisenstoffwechsels und Kupfer) im Normbereich
- keine subjektiven Beschwerden
- Vater an einem Lebertumor verstorben
- Alkoholkonsum glaubhaft selten und wenig, CDT-Wert normal,
- keine Belastung mit lebertoxischen Substanzen beispielsweise am Arbeitsplatz
- keine Vormedikation
- normaler Allgemein- und Ernährungszustand; 1,75 m, 76 kg, BMI 24,8 kg/m²
- keine Zeichen eines Ikterus, keine Haut-Leber-Zeichen, keine weiteren klinischen Auffälligkeiten
- Hepatitisserologie negativ, Ausschluss einer akuten oder chronischen Infektion
- sonografisch unauffälliges Leberparenchym, normale Organgröße, keine pathologischen Veränderungen der Gallenwege
- Elastogramm der Leber ohne pathologischen Befund
- CT-Abdomen ohne pathologischen Befund
- kein Hinweis auf (angeborene) Stoffwechselerkrankungen mit Affektion der Leber
Ernährungsanamnese des gesundheitsbewussten Patienten:
normokalorische, vollwertige, vorwiegend vegetarische Vollkost
In der detaillierten Befragung gab der Patient dann an, sich bewusst gesund und zur Steigerung der Vitalität oft mit „Superfood“ zu ernähren. Er verwende daher zu jeder der 3 täglichen Mahlzeiten größere Mengen Curcuma, sodass er durchschnittlich davon 80-100 g des Gewürzpulvers pro Woche verbrauche. Nahrungsergänzungsmittel nehme er nicht ein.
Ernährungstherapeutische Intervention:
Fortsetzung der aktuellen Kost, aber Verzicht auf Curcuma
Verlauf:
In den Laborkontrollen nach 2 Monaten, 4 Monaten und 6 Monaten Rückgang und letztlich Normalisierung der initial erhöhten Transaminasen
Hintergrund:
Curcuma, die Gelbwurzel aus der Familie der Ingwergewächse, ist ein traditionelles Gewürz der asiatischen Küche, Bestandteil des Curry-Pulvers und der Lebensmittelfarbstoff E 100, dem positive Auswirkungen auf den Lipidstoffwechsel, leberprotektive, antientzündliche, anti-aging und antidepressive Wirkungen zugeschrieben werden, der in der traditionellen asiatischen Medizin eingesetzt wird und besonders bei Verdauungsbeschwerden, Gelenkerkrankungen, Malignomen, Demenz oder Depressionen helfe.
Das Interesse an Curcumin (Diferuloylmethan) als Wirkstoff aus Curcuma longa als potentielles Nutrazeutikum hat zugenommen. Trotz der aus Studien abgeleiteten Hinweisen auf positive Wirkungen fehlt weiterhin eine pharmazeutische Evidenz. Curcumin scheint zahlreiche Signalmoleküle mit ungeklärter Auswirkung auf den Verlauf der adressierten Erkrankungen modulieren zu können, weist jedoch eine geringe Bioverfügbarkeit auf. (1, 2)
Unter anderem werden auch leberprotektive Wirkungen von Curcumin postuliert. (7)
Durch Zusatz von Piperin als wirksamer Substanz des Pfeffers wird besonders in Nahrungsergänzungsmitteln versucht, die Bioverfügbarkeit von Curcumin mit unkalkulierbaren Ergebnis zu verbessern.
Das Gefährdungspotenzial von Curcumin wurde in der Vergangenheit im Rahmen der Zulassung von Curcumin als Lebensmittelzusatzstoff bewertet. Von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) wurde dabei ein ADI (Acceptable Daily Intake) von 3 mg/kg Körpergewicht (KG) und Tag bestimmt. (3,4,5,6)
Potenziell leberschädigende Effekte wurden bei Curcumin-haltigen Produkten (Nahrungsergänzungsmitteln) mit verbesserter Bioverfügbarkeit durch Zusatz von Piperin zwar bereits beobachtet, zum Teil enthielten diese Produkte aber auch weitere Bestandteile, die ebenfalls dafür (mit)verantwortlich sein könnten. Transaminasenerhöhungen nach Genuss von reichlich Curcuma-Gewürzpulver sind nicht dokumentiert.
Veränderungen bei Leberfunktionstests (z. B. Anstieg der Transaminasen) sind in klinischen Interventionsstudien mit einer Inzidenz von 5 % aufgetreten. Es wurde postuliert, dass es sich bei den beobachteten leberschädigenden Effekten nicht unbedingt um eine direkte toxische sondern auch um eine idiosynkratische Wirkung, also eine meist angeborene Überempfindlichkeit, handeln könnte, bei der kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Dosis und Effektstärke besteht. (8,9)
Bereits über die Verwendung von Curcumin als Lebensmittelfarbstoff E100 können nach einer Schätzung der EFSA mittlere Aufnahmemengen von 0,2-0,6 mg/kg KG sowie maximale Aufnahmemengen von 0,4-1,5 mg/kg KG bei Erwachsenen erreicht werden (EFSA 2014).
Im beobachteten Fall betrug der durchschnittliche tägliche Verzehr von Curcuma-Gewürz 180 mg/kg KG, die wirksame Menge Curcumin dürfte daher die vorgegebenen Grenzwerte (deutlich) überschritten haben. Nach Ausschluss möglicher Differenzialdiagnosen für die Transaminasenerhöhung des Patienten wurde diese durch direkte toxische Wirkung oder aber idiosynkrastische Effekte des verzehrten Curcumin-Gewürzpulvers verursacht und normalisierte sich nach Einstellung der Aufnahme.
Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat bereits davor gewarnt, dass bei Einnahme von Curcumin als Bestandteil von Nahrungsergänzungsmitteln insbesondere in der Formulierung mit Zugabe von Piperin zur Verbesserung der Bioverfügbarkeit die akzeptable tägliche Aufnahmemenge überschritten werden kann (10).
Schlussfolgerung:
Diese Kasuistik zeigt, dass dies auch bei dem Verzehr von Curcuma als Gewürz in höheren Dosen mit einem die Leber schädigendem Effekt der Fall sein kann. Es kann differenzialdiagnostisch hilfreich sein, in der ernährungsmedizinischen Anamnese gezielt nach speziellen Ernährungsgewohnheiten, Superfood und Nahrungsergänzungsmitteln zu fragen.
Fall eingereicht von:
Dr. med. Henner Montanus
Chefarztes für Innere Medizin im Saale-Krankenhaus Calbe
Literatur:
-
- Kotha RR, Luthria DL. Curcumin: Biological, Pharmaceutical, Nutraceutical, and Analytical Aspects. 2019 Aug 13;24(16):2930
- Gupta SC, Patchva S, Aggarwal BB. Therapeutic roles of curcumin: lessons learned from clinical trials. AAPS J. 2013 Jan;15(1):195-218
- EFSA (European Food Safety Authority) (2014). Refined exposure assessment for curcumin (E 100). EFSA Journal 12: 3876.
- EFSA (European Food Safety Authority: Scientific Committee) (2017). Update: Use of the benchmark dose approach in risk assessment. EFSA Journal 15(1): 4658: 1-41.
- EFSA (European Food Safety Authority: Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP)) (2020). Safety and efficacy of turmeric extract, turmeric oil, turmeric oleoresin and turmeric tincture from Curcuma longa L. rhizome when used as sensory additives in feed for all animal species. EFSA Journal 18: 6146.
- EFSA (European Food Safety Authority: Scientific Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS)) (2010). Scientific Opinion on the re-evaluation of curcumin (E 100) as a food additive. EFSA Journal 8: 1679.
- Sun H, Liu T, Wang Z, Shen W, Yuan X, Xie J, Zhang Y. Role of Curcumin in Chronic Liver Diseases: A Comprehensive Review. Drug Des Devel Ther. 2025 Apr 28;19:3395-3406
- Lombardi N., Crescioli G., Maggini V., Ippoliti I., Menniti-Ippolito F., Gallo E., Brilli V., Lanzi C., Mannaioni G., Firenzuoli F., Vannacci A. (2020). Acute liver injury following turmeric use in Tuscany: An analysis of the Italian Phytovigilance database and systematic review of case reports. British Journal of Clinical Pharmacology
- Lukefahr A. L., McEvoy S., Alfafara C., Funk J. L. (2018). Drug-induced autoimmune hepatitis associated with turmeric dietary supplement use. BMJ Case Reports 2018
- Bundesinstitut für Risikobewertung, Curcumin in Nahrungsergänzungsmitteln: Gesundheitlich akzeptable tägliche Aufnahmemenge kann überschritten werden, Stellungnahme Nr. 040/2021 des BfR vom 14. Dezember 2021